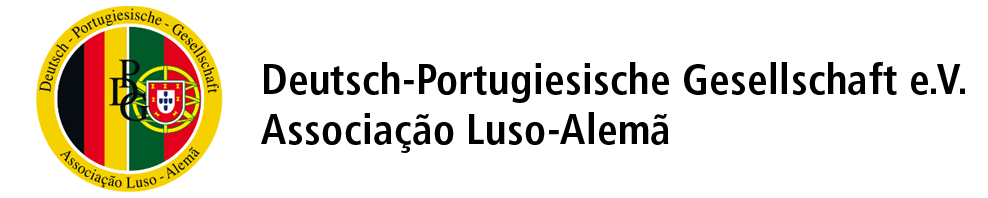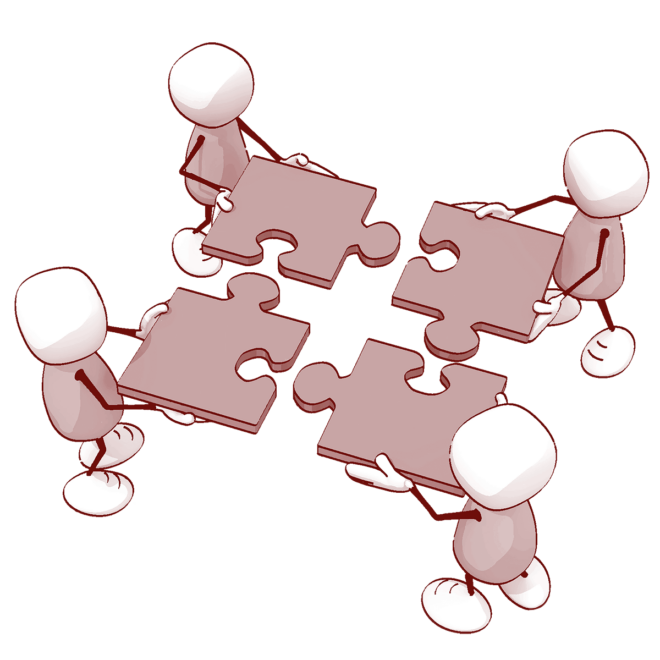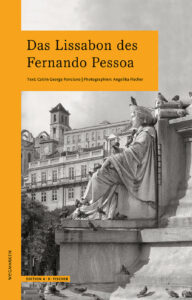Mit einem Lächeln: Interview mit Gabriele Baumgarten-Heinke über ihre Lebensgeschichte und die Zukunft der DPG • Fragen von Andreas Lahn
> PORTUGAL REPORT: Das Weihnachtsfest mit dem leckersten Essen hast du im Jahre 2000 in Portugal erlebt. Erinnerst du dich?
Gabriele Baumgarten-Heinke: Das war das erste gemeinsame Weihnachtsessen mit Harald Heinke, nachdem wir zusammengezogen sind. Wir sind in Portugal gewesen und am 24.12. von der Algarve nach Lissabon gefahren. Er wollte mir alles in Grândola zeigen, was mit der Nelkenrevolution zusammenhängt. Auf der Weiterfahrt war Stau, es goss in Strömen und als wir gegen 19 Uhr Hunger hatten, haben wir in einer Raststätte gegessen, mit drei vier alten Männern, die sich gefragt haben, was die denn hier machen. Wir haben ein KäseBaguette gekriegt. Ich wusste in dem Moment nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Aber das ist auch ein Stück Harald. Ich habe mich im Zusammenleben mit ihm daran gewöhnt, dass es Dinge gibt, die Vorrang haben wie z. B. die DPG und seine Arbeit. Wir haben das Festessen am 25.12. nachgeholt.
Gibt es für dich einen Lieblingsort in Portugal − vielleicht die Insel Madeira?
Wir haben auf Madeira viele Wanderungen an den Levadas entlang macht. Das viele Grün hat mich beeindruckt. Aber einen speziellen Lieblingsort habe ich nicht. Ich mag auch Lissabon, Porto die Algarve. Ich finde Portugal insgesamt und die Menschen einfach faszinierend.
Du bist ja 1955 in Guben in der ehemaligen DDR geboren. Welche Erinnerungen hast du an das Leben dort?
Da mag jeder unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Was mich traurig macht, ist, dass die DDR häufig auf Mauer und Staatssicherheit reduziert wird. Ich hatte eine ganz normale Kindheit. Für mich gab es Geborgenheit und Sicherheit durch die Familie. Wir haben gelacht und uns gefreut, wir sind zur Schule gegangen. Erst Ende der 1980er Jahre mit den großen Demonstrationen bin ich auf die Staatssicherheit (Stasi) aufmerksam geworden. Mir war vorher nicht bekannt, was in den Gefängnissen passiert ist oder dass Frauen die Kinder weggenommen wurden. Meine Kindheit möchte ich nicht missen. Ich hatte eine schöne Kindheit.
Drei Töchter durch das Leben zu begleiten ist nicht gerade einfach. Wie siehst du das?
Meine Töchter sind zu Freundinnen geworden. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Die eine lebt in Zürich und zwei in Dresden. Alle habe eine gute Ausbildung und haben Familien gegründet. Die Beziehung zu ihnen, unser Zusammenhalt, auch zu meinen Enkeln, ist für mich eine große Freude.
Du hast in der DDR als Lehrerin gearbeitet. Welchen Stellenwert hatte der Beruf? Und warum hast du aufgehört als Lehrerin für Russisch und Geschichte zu arbeiten?
Meine Töchter sind immer mal wieder abwechselnd krank geworden. Ich bin dadurch ab und zu ausgefallen und habe viel Druck gespürt nach dem Motto: »Hier warten 30 Kinder auf Sie, und Sie haben nur zwei.« Ich konnte die beiden ja nicht an der Garderobe abgeben. Das war für mich der Grund, die Volksbildung zu verlassen, was natürlich nicht einfach war.
Ein Schlüsselerlebnis sozusagen?
Ja, genau. Ich brauchte die Hilfe eines Arztes, um aus der Volksbildung ausscheiden zu können. Durch die Sprachausbildung in Russisch habe ich bei der IHK Zertifikate als Reiseleiterin/Dolmetscherin gemacht und dann in der DDR Reisegruppen aus der ehemaligen Sowjetunion nach Berlin, Erfurt, Leipzig, Dresden begleitet. Das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht.
Du bist Inhaberin des Reiseunternehmens i-Punkt in Dresden gewesen. Wie hast du das Ende der DDR erlebt und warum hast du das Reisebüro aufgegeben?
Das war eine spannende Zeit. Ich war keine, der man vorgeben musste, was sie zu tun und zu lassen hatte. Man musste sich einen Platz suchen und die Frage beantworten: Was will ich, wo gehöre ich hin? Ich war bei der Dresden-Information und hatte das große Glück, dass Hamburg und Salzburg Städtepartner von Dresden waren. VertreterInnen dieser beiden Städte sind auf uns zugekommen und haben nach Möglichkeiten gesucht, uns touristisch zu unterstützen. Wir haben ins Salzburger Land einen Bus-Pendelverkehr aufgebaut. Auf der Straße war eine lange Schlange, so dass man dachte, es gäbe Bananen. Aber die Leute wollten alle diese Reisen kaufen. Doch dann hat die Stadt Dresden gefordert, diesen »Reisedienst der Stadt Dresden« abzuwickeln, weil Reisebüros nach westdeutschem Recht nur privat sein dürfen. Ich habe beschlossen, das Reisebüro zu privatisieren. Das war mutig, weil wir von der großen weiten Welt nicht viel Ahnung hatten. Auch mit Computern und den Programmen mussten wir lernen umzugehen. Ich war auf vielen Lehrgängen, habe das Ausstellen von Flugtickets (Ticketing) und auch das Buchen selbst gelernt. Eines Tages stand ein Kunde im Reisebüro und will zum Popocatépetl. Ich dachte: Will er was zu essen oder was meint er? Am Anfang wussten Kunden, die ganz gezielt irgendwo hinwollten, mehr als wir. Wir haben sie gefragt, warum sie dann gerade da hin wollen. Dann haben die Leute erzählt und wir wussten, welchen Katalog wir ihnen mitgeben konnten. Ich war seit 1990 Mitglied des Deutschen Reiseverbandes (DRV), genau das Unternehmen, bei dem ich 2019 mein Arbeitsleben beendet habe. 1996 sollten wir für das Reisebüro eine 300 Prozent höhere Miete zahlen. Da es mittlerweile viele Reisebüros gab, war der Markt schon aufgeteilt und das Risiko an einem neuen Standort zu groß. Ich habe sechs Jahre die freie Marktwirtschaft ausprobiert und genoss in den folgenden Jahre die Vorteile des Angestelltendaseins. Ich bin dann Büroleiterin eines FIRST-Reisebüros in der Dresdener Neustadt geworden.

Blick auf das nächtliche Dresden · Foto: © Felix Mittermeier auf Pixabay
Das wäre ja cool für die DPG, selbst Reisen nach Portugal zu organisieren, zumal du nach etlichen Jahren in verschiedenen Unternehmen der Reisebranche über ausreichend Erfahrung verfügst?
In diesem FIRST-Reisebüro tauchte einens Tages ein Herr Heinke als Direktor von OLIMAR auf und sagte: »Ihr Umsatz bei OLIMAR lässt aber schon zu wünschen übrig.« Ich habe dann gekontert und geantwortet: »Ich weiß zwar, wo Portugal liegt und dass Lissabon die Hauptstadt ist, aber ich war noch nie dort.« Er hat mich dann auf eine Info-Reise mitgenommen, mir Orte und einige Hotels gezeigt, so dass ich danach Reisen nach Portugal ganz anders verkaufen konnte. Und − wie es so seine Art ist − hat er mir einen Zettel hingelegt und gesagt, ich könne dann ja auch gleich Mitglied der Deutsch-Portugiesischen Gesellschaft werden. Das war 1998. Ich sollte dann auch gleich die Stadtsektion Dresden übernehmen, was ich auch gemacht habe, obwohl andere Mitglieder natürlich mehr über Portugal wussten als ich.
Das ist ja jetzt 23 Jahre her. Was hat sich aus deiner Sicht im Laufe der Jahre in der DPG verändert?
Ich habe ja noch den damaligen Präsidenten Peter Neufert kennenlernen dürfen und war bei vielen Veranstaltungen dabei. Ich glaube, damals ist der Enthusiasmus größer gewesen als heute. Es gab mehr aktive Leute, auch in den Landesverbänden. Wenn ich an die Urgesteine der DPG denke, kam von denen sehr viel Energie. Man hat sich häufig gesehen, es gab regelmäßige Präsidiumssitzungen. Dann hat Harald das Amt als Präsident übernommen. Er hat das super gemacht und konnte seine ganzen Kontakte in alle lusophonen Länder und viele Vereinigungen in die DPG einbringen. Vielleicht hat er einigen Leuten sogar zu viel Arbeit abgenommen. Im Moment ist es eher so: Wenn nichts vom geschäftsführenden Vorstand angeschubst wird, hört man zu Corona-Zeiten doch sehr wenig von den Landesverbänden. Das macht mir auch ein wenig Sorgen, muss ich gestehen.Manchmal stelle ich mir die Frage: Schläft durch Corona alles ein oder was passiert hier gerade?
Du bist Schatzmeisterin in der DPG. Wie ist der Verein für die Zukunft aufgestellt? Stimmen die Finanzen?
Nicht nur die DPG, sondern Vereine ganz allgemein haben in Deutschland mit vielen Problemen zu kämpfen. Deshalb haben wir uns ja im Juni 2021 zum Strategie-Workshop getroffen. Die Mitgliederzahlen sinken und viele der langjährigen aktiven älteren Mitglieder fallen irgendwann einmal weg. Mehr Mitglieder zu akquirieren und einzubinden, bleibt aus meiner Sicht schwierig. Weniger Mitglieder heißt auch weniger Beitragseinnahmen. Hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Denn wenn weniger Geld zur Verfügung steht, kann man auch weniger machen. Und wenn wir weniger machen, können wir weniger Leute von der DPG begeistern. Ich habe mich gefreut, dass über deine Spendenaktion Geld reingekommen ist, was uns mehr Rückhalt gegeben hat. So steht als Ergebnis des letzten Jahres ein schönes Plus. Man muss das Ganze aktiv halten, sonst schläft irgendwann alles ein.
Durch die Pflege des langjährigen Präsidenten der DPG, Harald Heinke, zu Hause hat sich dein Leben verändert. Wie kommst du mit den Anforderungen zurecht?
Das war eine schwierige Situation. Seine Krankheit kündigte sich bereits 2014 und auch 2016 an. Aber damals konnte ich noch arbeiten gehen. Er hat versucht, das Beste daraus zu machen und ist mit dem Rollator gegangen. Schon damals hat mir der Pflegedienst geholfen. Im März 2019 musste ich dann in zehn Tagen entscheiden, ob er ins Pflegeheim soll oder ob ich ihn zu Hause pflege. Ich hätte damals eigentlich noch zwei Jahre arbeiten müssen. Diese Situation stülpt das Leben von jetzt auf gleich um. Da er Pflegegrad 5 hat und die Krankheit fortschreitet, habe ich beschlossen, meinen Beruf aufzugeben. Ich kenne mich gut mit dem Computer aus und stelle fest, dass es in diesem Land unendlich viel Hilfe gibt, wenn jemand krank ist. Ich habe jetzt drei Pflegedienste im Einsatz und muss trotzdem nichts zuzahlen. Man muss viel recherchieren über Webseiten wie pflegehilfe.de und andere. Mit der Hilfe komme ich selbst gut zurecht. Nach zwei Jahren werde ich oft von anderen Pflegenden um Rat gebeten. Doch mit 18 Pflegeterminen pro Woche bleibt für mich selbst wenig Freizeit.

Gabriele Baumgarten-Heinke im Schlosspark Niederschönhausen · © Foto: privat
Beim Walken in der Natur versuchst du abzuschalten. Wohin gehst du?
Oftmals hier um die Ecke in die Gartenanlage, aber lieber in den Schlosspark Niederschönhausen. Das Schloss dort ist ja der Sitz der früheren DDR-Regierung. Ich gehe nicht deshalb dorthin, sondern weil da ein wunderschöner Park ist. Da fließt die Panke durch, und für mich ist das dann der Moment in der Natur, um abzuschalten und was für mich zu tun.
Zur Entspannung praktizierst du Yoga. Hast du dafür genug Zeit?
Ich gehe Donnerstags zum Vereinssport. Wir machen leichte Übungen wie Stretching, und Yoga. Manchmal fühle ich mich vorher kaputt, aber ich raffe mich dann auf, weil ich weiß, dass mir das sehr viel Energie gibt. Die Sportgruppe ist auch ein Treffen von FreudInnen.
Du betreibst Ahnenforschung. Wie weit lässt sich der Stammbaum zurückverfolgen?
Bisher noch nicht so weit. Ich habe aber herausgefunden, dass der Großvater meiner Mutter im ersten Weltkrieg verschollen ist, in Frankreich. Ich weiß, dass sein Grab noch existiert und wo es ist. Ich finde es spannend, wenn man plötzlich Post bekommt und dann weiß, wer die Vorfahren sind und wo sie abgeblieben sind. Das macht richtig viel Spaß.
Warum bist du damals von Dresden nach Berlin gezogen?
Ich bin aus Liebe zu meinem Mann Harald Heinke nach Berlin gezogen. Ich war eine eingefleischte Sächsin. Zu DDR-Zeiten gab es einen Kleinkrieg zwischen Dresden und Berlin. Viele Gelder sind nach Berlin geflossen, weil Berlin als Schaufenster der DDR ausstaffiert werden sollte. Als Marzahn gebaut wurde, sind auch Arbeitskräfte abgezogen worden. Doch durch den Einsatz einiger engagierter Menschen sind zum Aufbau von Semper-Oper, Zwinger etc. auch einige Gelder nach Dresden geflossen. Auch beim Fußball gab es eine große Konkurrenz: Dynamo Dresden und Union Berlin waren nicht die besten Freunde. Berlin war nie der Traum meines Lebens. Doch als Harald zu mir sagte, wir sollten schon zusammenleben, bin ich spontan hierher gezogen. Ich hatte ein wenig Scheu und habe mich gefragt, ob die Berliner mich als Sächsin akzeptieren. Doch das war einfacher als gedacht. Berlin ist so Multikulti, hier leben Sachsen und Schwaben, man trifft überall interessante Menschen. Es ist viel menschlicher und herzlicher als ich es mir vorgestellt habe.
Das Multikulti der Menschen ist sehr angenehm. Ich mag auch die Vielfalt in der Kultur. Und trotz der Größe gibt es in Berlin viele grüne Oasen. Hier um die Ecke in Wedding ist der Plötzensee. Du kannst mitten in der großen Stadt im See schwimmen gehen. Es gibt viele große Parks, und einige Kilometer weiter wird jetzt das Moor renaturiert. Ich finde das alles unglaublich. Das Leben in Berlin ist schön, aber ich wohne ja auch nicht ganz mittendrin. Trotzdem bin ich schnell im Zentrum. Das Leben in den vielen Kiezen ist ganz anders als in Berlin-Mitte.
Magst du Museen?
Ja, vor allem die historischen Museen auf der Museumsinsel. Ich bin unheimlich gerne im Pergamon-Museum. Obwohl ich schon x-mal dort war, fasziniert es mich immer wieder. Ich bin auch gespannt, was es im Humboldt Forum, im Berliner Schloss, zu sehen gibt. Das will ich mir in diesem Jahr angucken. Ich bin auch mal im Dom auf den Turm gestiegen. Der Blick über die Stadt ist auch sehr schön .
Toleranz und Optimismus sind dir wichtig. Außerdem möchtest du die Welt besser machen. In Zeiten von Corona gewinnt dein Lebensmotto an Bedeutung: »Wir haben nur das eine Leben.«
Genau so ist das! Wenn Menschen sich mit einem Lächeln begegnen, wenn man aufeinander zugeht und miteinander redet, läuft alles freundlicher und schöner. Jetzt sind Wahlen. Ich kann es einfach nicht verstehen zu sagen: »Das bringt nichts. Ich gehe da nicht hin!« Eine Politikverdrossenheit bringt uns nicht voran. Aber was tun diejenigen denn? Es gibt sicher keine Partei, die zu 100 Prozent die Wünsche eines jeden einzelnen umsetzen kann. Dazu sind die individuellen Vorstellungen Menschen viel zu verschieden. Aber einfach mal in die Programme der Parteien schauen, sich damit auseinandersetzen und dann entscheiden, was für einen wichtig ist. Für mich ist soziale Gerechtigkeit wichtig. Dazu gehören u. a. Mindestlöhne, der Kampf gegen Kinderarmut, den Pflegenotstand stoppen und gerechte Renten. Wichtig sind mir auch die Stärkung der Demokratie, die Klimagerechtigkeit und der Stopp von Rüstungsexporten.
Ich bin der Meinung, dass diese Erde, dass die Natur den Menschen loswerden will, und sagt: »Es reicht! Ihr Menschen habt alles kaputt gemacht, jetzt wehren wir uns!« Die Auswirkungen spüren wir alle, sie sind nicht zu übersehen. Und deshalb müssen wir viel mehr tun, um die Natur zu retten und auch unseren nachfolgenden Generationen die Chance einräumen, auf dieser Erde ein schönes und friedliches Leben zu haben.
Und im Alltag bedeutet dies, einfach ein bisschen aufeinander zu achten, miteinander zu reden, die Natur zu respektieren und mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen. Dann geht vieles einfacher, leichter und schöner.