von Catrin George Ponciano
> Sonntag, 15.11.2020, zehn Uhr. Sonnenschein hat den morgendlichen Himmel erobert. Die Wärme des Lichts tut wohl. Meine Katze sitzt auf einer Stufe und blinzelt, ihre Schnurrbarthaare sondieren die Wetterlage. Ich tue es meiner Katze gleich und strecke mein Gesicht den wärmenden Strahlen entgegen, atme tief durch die Nase. Ein rundum friedlicher Moment, einen, den man gerne einfrieren möchte um ihn in unangenehmen Situationen bei Bedarf hervorholen und daran lutschen können wie an einem süßen Eis.
In meinem Patio schaukeln Orchideenblüten in sanfter Brise. Sie kündigen die Einkehr des Winters an. Pünktlich an Allerheiligen − und werfen die Blüten ab zum Frühlingsbeginn am 21. März.
An den letzten Einzug von Primavera mag sich in diesem Jahr niemand gerne erinnern. Die bis dato seit Beginn des Jahres lediglich aufgeregt versprengten, teilweise vage und kryptisch formulierten Nachrichten über eine Viruskrankheit, die sich global ausbreitet, hatte eben Italien und den Karneval von Venedig erreicht und kurz darauf die ITB in Berlin, und dazu geführt, dass beide Veranstaltungen abgesagt worden sind.
Das für Februar geplante Schwesterntreffen zwecks literarischer Fährtenlese fand trotzdem statt. In Lissabon. Ausgelassen eroberten meine Schwester und ich die Kapitale Portugals, speisten Entenreis in Fernando Pessoas Lieblingsrestaurant Martinhos da Arcada, bestaunten José Saramagos Ebenbildskulptur in seinem Museumshaus mit einem Sprengstoffgürtel aus Büchern umgebunden, diskutierten über seine Nobelpreis Utopie Die Stadt der Blinden, spönnen eigene Utopien, und ahnten nicht einmal ausgedacht, wie rasch das Unmögliche Wirklichkeit wurde.
Auf unserer Fährte nach Inspiration fuhren wir nach Coimbra, wo wir die heiligen Hallen des Wissens erlebten. Das Gewicht beschriebenen Papiers, das in der weltberühmten Joanina-Bibliothek Jahrhunderte alte Geschichten und Erkenntnisse hütete, sank ein in uns wie der Stein der Weisen, und wir weinten still in Ehrfurcht vor dem Vermächtnis für die Menschheit. Der mit geschriebenen Worten gefüllte Kelch benetzte unseren Geist mit Ideen und Figuren, bis sich die Muse sattgetrunken hatte.
Erfüllt von der Vielfalt geteilter Gedanken nahmen wir am Flughafen in Lissabon glücklich Abschied voneinander und mit dem Versprechen, uns bald wiederzusehen.
Drei Wochen später warfen meine Orchideen ihre Blüten ab. Und der Ministerpräsident Portugals rief den Ausnahmezustand aus. Die Grenze zu Spanien wurde abgeriegelt. Touristen ausgeflogen. Hotels geschlossen. Restaurants, Cafés, das gesamte Land machten die Schotten dicht. Portugal im Lockdown. Europa im kollektiven Schreck. Die Welt stand plötzlich still. Nichts war mehr so wie gestern. Die Utopie hat uns eingeholt.
Der Schock glich einem globalen Erdbeben. Nur fand das Beben im Inneren statt. Im Unsichtbaren − dort − was wir Seele nennen.
Ich halte inne, habe diesen Text Andreas noch heute versprochen. Mein Blick wandert zum Fenster. Eben geht meine Nachbarin Valentina davor vorbei. Ihr Mundschutz baumelt an ihrem Handgelenk. Ratlos steht sie vor der verschlossen Tür des Minimercados nebenan, sehe ich. Sonntags ist der Laden geschlossen, steht auf dem Schild. Valentinas Blick wandert zu ihrer Armbanduhr, sie schüttelt den Kopf, versteht nicht, warum um elf Uhr der Laden nicht offen ist. Lesen kann Valentina nicht, die meisten ihrer Generation können es nicht, kannten die Mädchen, die heute Großmütter sind in Portugal eine Schule bloß von außen. War das wirklich erst 46 Jahre vorbei?
Mein Fenster zur Straße in meinem Büro ist intim ein Ausguck nach draußen. Während des 63 Tage, von Mitte März bis Mitte Mai, andauernden Lockdowns nahm ich am Leben außerhalb der eigenen Wände bloß passiv teil, und meine Nachbarn und ihre Gesichter schraffiert, getrennt durch die Glasscheibe wahr. Ein Bullauge, mein Heim ein sicheres Schiff. Ich blieb unsichtbar. Anwesend und dennoch abwesend.
Beim geöffneten Fenster erreichte mich zusätzlich die Melodie ihrer Worte, das Moll ihrer Sorgen im Stakkato ihrer Angst, hier und da übertönt von hysterischen Trillern.
Die sich sonst herzen und busseln, stehen mit dem Rücken zur Wand am Haus gegenüber, halten Abstand zueinander, beäugen Fremde. Mit Misstrauen. Ihre Mienen, sonst unschuldig weltoffen, wirken nun zerbrechlich, brüchig wie Porzellan. Die einen erledigen Einkäufe, diszipliniert, geordnet in Reih und Glied warten sie bis sie dran sind, immer nur zwei Personen auf einmal dürfen ins Geschäft. Andere gesellen sich dazu − zufällig − behaupten sie. Ist die Straße vor dem Supermarkt der einzige Ort im Dorf, wo die Einsamkeit Luft holen kann und für kostbar zwischenmenschliche Momente die Verunsicherung besänftigt.
Mein Fenster zur Straße gleicht einer Reality-Show, beschert mir der Ausblick einerseits abstrakt Abstand zur Außenwelt, andererseits auch surreale Nähe. Mein heimliches voyeuristisches Dabeisein macht das verwirrende Zeitalter der Pandemie für Sekunden erträglich, und gleichzeitig so unerträglich, dass ich in den Hof flüchte, hinter die Mauer, die mir den Ausblick auf die Straße verwehrt, wo ich im Schatten kauere, Bücher wie einen Schutzwall um mich herum aufgebaut, als könnten die Worte der toten Dichter mich beschützen. Vielleicht können Bücher das tatsächlich. Vielleicht können Bücher sogar die Menschheit retten. Uns Mut, Ablenkung, Hoffnung, Träume schenken.
Ich schließe das Fenster. Leise. Mit Bedacht, und denke an Fernando Pessoas bedrückende Worte über das Fensterglas in seiner Wohnung: Eine durchsichtige, dennoch undurchdringliche Wand, die mich von den Gedanken und Gefühlen der anderen trennt, und die nie meine sein werden.
Ich setze mich wieder, schreibe den Text zu Ende, und begreife, mein Fenster ist mein Ausguck, damit ich auch künftig zu träumen wage − und eines Tages, gar nächstes Jahr, befreit vom Gewicht der trostlosen Gedanken, ausgelassen den Wellen entgegen rennen kann.
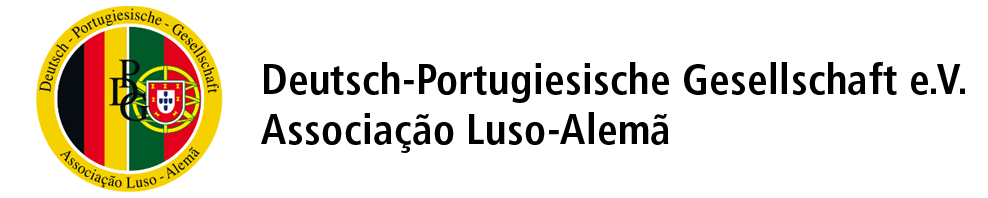
 Ein besonderes Fenster · © Catrin George Ponciano
Ein besonderes Fenster · © Catrin George Ponciano