Ilha dos Tigres
Portugiesische Ruinen im Sandsturm • von Andreas Lausen
> Es gibt wohl keinen anderen Ort, der so lebensfeindlich und öde ist wie diese Insel (bis 1962 Halbinsel) am südlichen Zipfel der angolanischen Atlantikküste, 40 Kilometer nördlich vom Grenzfluss Cunêne und dem Nachbarland Namibia.
Diese völlig kahle Sandinsel (98 km2, 35 Kilometer lang, bis zu 6 Kilometer breit und mit bis zu 30 Meter hohen Dünen bedeckt) ist Teil der Namib-Wüste und wurde 1486 von dem portugiesischen Seefahrer Diogo Cão entdeckt. Die Wellenmuster der riesigen Dünen auf der gegenüberliegenden Küste des afrikanischen Festlands brachten der Region den Namen Baía dos Tigres ein.
Später liefen Niederländer und Briten die unbewohnte Bucht an. Die Holländer gaben der Insel den finsteren Namen Doodsakker, aber sie bemerkten den Reichtum an Fisch, der bis heute mit dem kalten Benguela-Strom vor die Küste Angolas kommt.
Als Mitte des 19. Jahrhunderts die europäischen Großmächte die weißen Flecken der afrikanischen Landkarte aufspürten und unterwarfen, sah Portugal seine größte Kolonie Angola gefährdet. So reifte in Lissabon der Plan, portugiesische Siedlungen im abgelegenen Süden Angolas zu gründen. Im Algarve wurden 300 Siedler angeworben, meist junge Fischerfamilien, und ab 1860 auf die Tiger-Halbinsel gebracht.
Die Lebensbedingungen dort können kaum feindlicher sein: beständiger Westwind, der oft zum Sandsturm wird, Sand, der durch alle Ritzen dringt, tagsüber Hitze, 365 Tage im Jahr sengende Sonne, nachts eisige Kälte. Die einzige Feuchtigkeit bringt der Morgennebel. Keine Bodenschätze, nicht einmal Trinkwasser. Kein Baum, kein Strauch. Versorgungsgüter, auch Trinkwasser, mussten nach einer Seereise von 100 Kilometern aus dem nächsten Ort Porto Alexandre (ab 1976: Tômbua) geholt werden.

Ilha dos Tigres: Prozession am St.-Martins-Tag 1961 · © Foto: Blog von Maria Nídia Jardim
Die Algarvios machten sich an die Arbeit. Aus den reichlich vorhandenen Baustoffen Sand, Muschelkalk und Salzwasser bauten sie ihre Hütten und Häuser. Sie fischten von ihren mitgebrachten Booten aus und trockneten den Fang am Ufer. Ein Landungssteg wurde gebaut, an dem auch Seeschiffe festmachen konnten. Die Siedlung erhielt den Namen São Martinho dos Tigres.
Der Handel mit Trockenfisch, Fischöl (damals für Lampen gebraucht) und Fischmehl entwickelte sich gut. Bald fehlten Arbeitskräfte. Sie wurden aus dem Binnenland Angolas geholt, wo die Völker der Mucurocas und Himbas lebten. Sie hatten sich seit Jahrtausenden an das Leben in der Wüste angepasst. Kamen sie freiwillig? Wohl kaum, obwohl Portugal die Sklaverei verboten hatte.
1900 wurde eine Kirche errichtet, ein Friedhof mit Kapelle wurde angelegt. Ein kleines Krankenhaus wurde gebaut, dazu eine Zollstation, ein Kraftwerk und eine Schule für die ersten vier Klassen. Ein Kino brachte Abwechslung in den rauen Alltag. Ab 1922 machte eine der weltweit ersten Meerwasser-Entsalzungsanlagen (22.500 Liter pro Tag) das Leben etwas leichter. Aber ein finsteres Gefängnis erinnerte daran, dass auch dieser entlegene Landstrich Teil von Salazars Estado Novo war.
Mit dem Bau einer 35 Kilometer langen Trinkwasserleitung zur Cunêne-Mündung (1955) hatten auch die Fischfabriken ihre Wasserprobleme gelöst. 14 Betriebe verarbeiteten den Fisch, sodass die Tigerinsel bis 1962 der größte Fischereihafen Angolas war. Bäume und kleine Gärten brachten etwas Grün. Eine 1.000 Meter lange betonierte Piste, zugleich die Hauptstraße des Ortes, ermöglichte die Flugverbindung mit der Distrikthauptstadt Moçâmedes (die Stadt erhielt 2016 ihren alten Namen zurück).
1962 begann der Niedergang des Ortes. Eine Sturmflut riss die Landzunge zum Festland weg und mit ihr die Wasserleitung. Vom Festland war die Insel jetzt durch einen sechs Kilometer breiten Meeresarm getrennt. Die Einwohnerzahl sank von 1.500 auf 1.068 in 400 Wohnungen (1973).
Die Nelken-Revolution am 25.4.1974 und die bevorstehende Unabhängigkeit Angolas versetzte − anders als sonst − weiße und schwarze EinwohnerInnen in Angst. Als die Fischereibetriebe aus Furcht vor einer Enteignung ihre Schließung verkündeten, fiel die Lebensgrundlage der Menschen weg. 1975 verließen in wenigen Tagen alle weißen und schwarzen EinwohnerInnen ihre Insel. Sie flohen in die unbekannte Heimat ihrer Vorfahren.

Ilha dos Tigres: Eine Halle der Fischfabrik, 1975 verlassen · © Foto: Blog von Maria Nídia Jardim
Seitdem regiert wieder die Wüste auf der Insel. Gärten und Friedhof sind unter Sand begraben, viele Wohnhäuser hat der ständige Wind zerstört. Für die stabileren öffentlichen Gebäude ist eine neue Gefahr dazu gekommen: Trotz der abgeschiedenen Lage schaffen es ab und zu Menschen mit zerstörerischen Absichten auf die Insel. Sie hinterlassen ihre Tags und zerschlagen, was noch heil ist.
Die Glocke der Kirche, die noch ab und zu im Sturm läutete, wurde von einem Fischkutter mit einem Tau aus dem Turm gerissen und als Schrott verkauft. Auch die Kirchbänke wurden geklaut und als Lagerfeuer verheizt. Andere unerwünschte Besucher setzen mit Allrad-Jeeps auf die Insel über und veranstalten Wettrennen in den empfindlichen Dünen oder schießen Seevögel. Im Atlantik machen fremde Trawler Jagd auf Fisch für die Fischmehl-Produktion. Der Reichtum des angolanischen Meeres landet in chinesischen oder europäischen Futtertrögen, ohne dass Angola irgendeinen Nutzen davon hätte.
Aber einige Schornsteine sind noch stehen geblieben und ragen aus dem Sand. Sie sind den typischen Kaminen der Algarve nachempfunden, der Heimat der ersten Siedler, wo inzwischen die meisten ihrer Nachkommen wieder zuhause sind.
Nach den Vorstellungen der Provinzregierung in Moçâmedes soll die Insel eine Zukunft haben. Sie ist immer noch eine eigenständige Gemeinde in Angola − ohne Menschen, aber mit einem Bürgermeister namens Ernesto Manuel Tchihihavo, der in Tômbua residiert. Er stellte 2021 im angolanischen Fernsehen das Projekt vor: Ansiedlung von 750 Menschen, Bau eines Kasinos und eines Hotels, dazu ein großer Kai, Anlauf von Kreuzfahrtschiffen, Wüstensafaris, Fischereitouristik und historische Rundgänge. Der Plan für ein neues Gefängnis scheiterte zum Glück.
Bescheidener sind die Vorstellungen einer Gruppe von AngolanerInnen und PortugiesInnen, die den Status des Weltkulturerbes für die Insel anstreben. Dies würde Massentourismus verhindern, aber den weiteren Verfall der Bauten in Kauf nehmen.
HINWEIS: Die Fotos sind mit freundlicher Genehmigung dem von Maria Nídia Jardim betreuten Blog entnommen: mossamedes-do-antigamente.blogspot.com
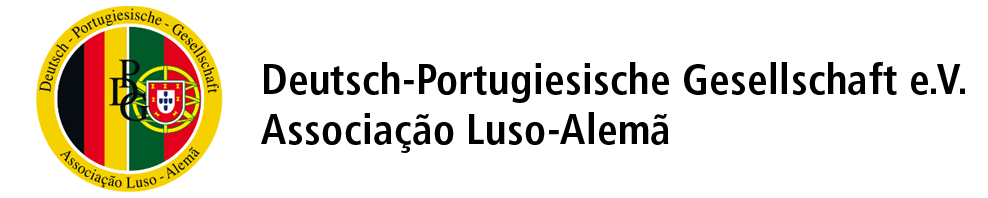
 Ilha dos Tigres: Sonnenuntergang über Kirche, Rollbahn und Krankenhaus · © Foto: Blog von Maria Nídia Jardim
Ilha dos Tigres: Sonnenuntergang über Kirche, Rollbahn und Krankenhaus · © Foto: Blog von Maria Nídia Jardim
Sehr interessant, tolle Fotos, Obrigado